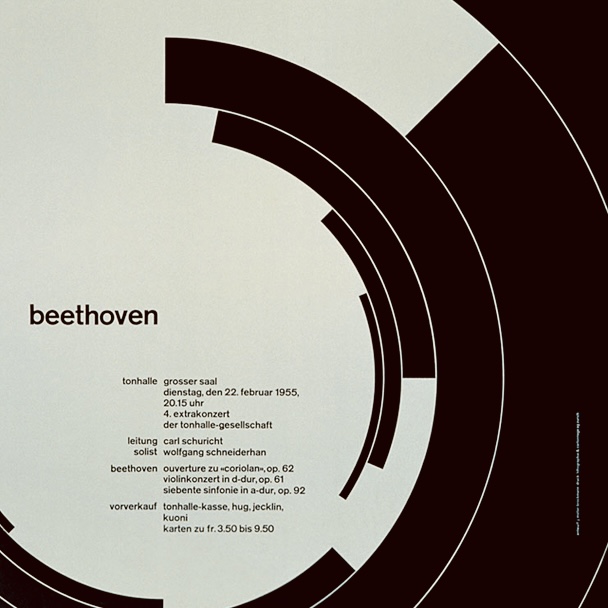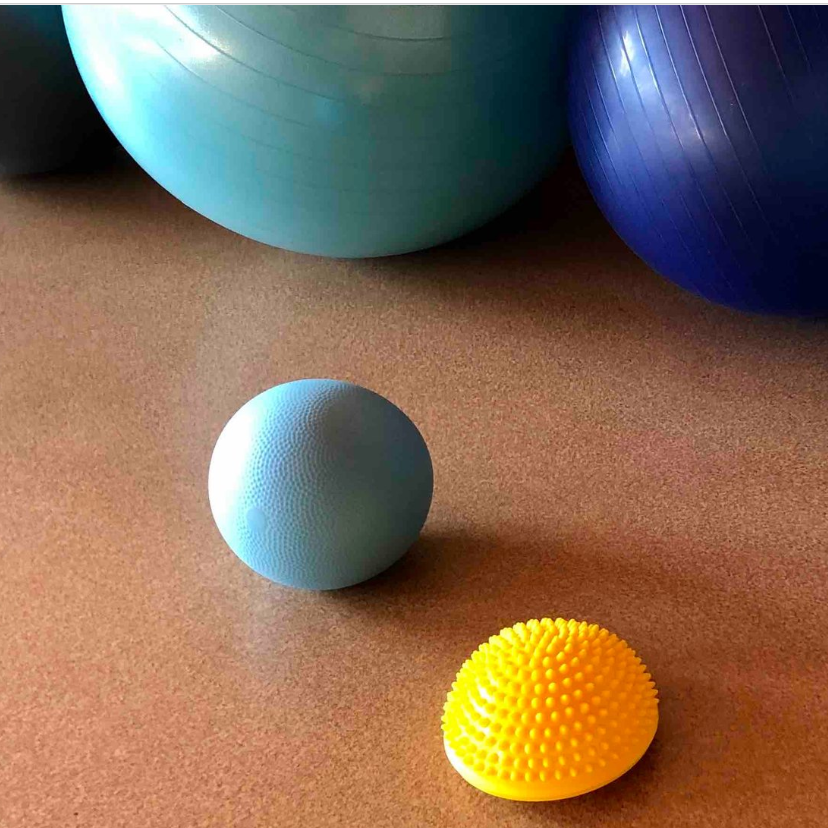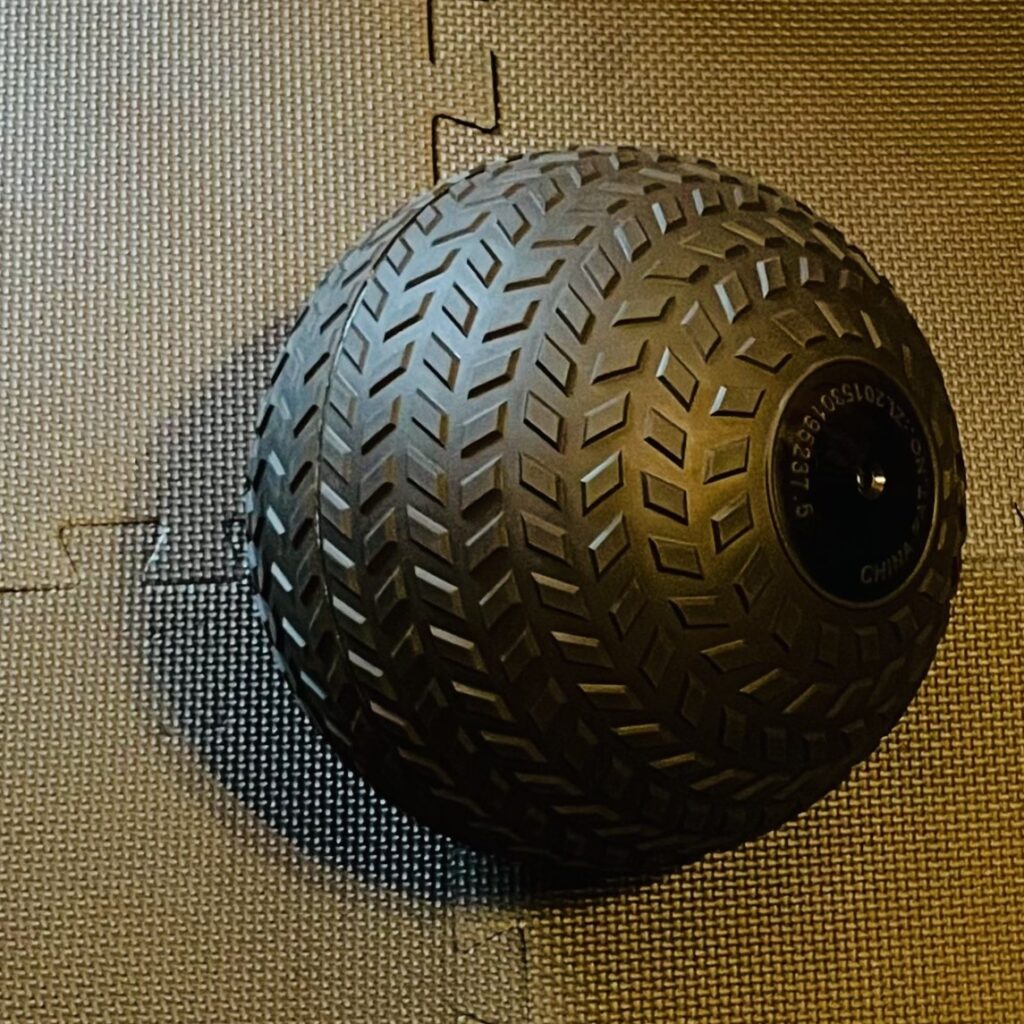High Protein Hype? DAs ist nur was für Bodybuilder.
Mit Protein-Supplementen wird viel Geld gemacht. So viel, dass „high Protein“ mittlerweile schon auf stinknormalem Magerquark steht. Für manche ist Proteinpulver ein No-Go, viele sind sich sicher: man isst auch so ausreichend Proteine.
Jein. Ja, Wenn man jung und gesund ist, sich moderat bewegt und erstens viel von allem essen kann und sich zweitens regelmässig mit Rührei, Milch und Rindersteaks verwöhnt. Nein, wenn man über 65 ist, viel Sport treibt, länger krank oder verletzt war, sich besonders ernährt oder mit Krafttraining angefangen hat – und erst recht nein, wenn alles zusammen kommt.
Ein Protein besteht aus Kettenartig miteinander verknüpften Aminosäuren, die durch Proteinbiosynthese im Körper aufgebaut werden. In unserem Körper kommen 20 verschiedene Aminosäuren vor, aus denen die vielen unterschiedlichen Proteinvariationen entstehen. Sie wirken als Hormone, Enzyme und Antikörper bei der Infektabwehr, die Gerüstproteine stabilisieren Bindegewebe und sind Bestandteile von Muskelnfasern, als Myosin und Aktin. 60% des Proteins, das wir im Körper haben, wird in unseren Muskeln gespeichert. Ein Kilogramm Muskelmasse besteht aus etwa 22 % Eiweiss, 70 % Wasser und 7 % Fett. Dabei sind Proteine in erster Linie ein Baustoff, und nicht direkt ein Energielieferant.
Von den 20 Aminosäuren sind 9 essenziell, das heisst, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen, weil wir sie nicht selbst herstellen können.
| essenzielle Aminosäuren | bedingt essenzielle Aminosäuren | nicht essenzielle Aminosäuren |
|---|---|---|
| Histidin | Tyrosin | Alanin |
| isoLeucin | Cystein | Asparagin, -säure |
| leucin | Arginin | Glutaminsäure |
| Lysin | Glutamin | |
| Methionin | Prolin | |
| Phenylalanin | Glycin | |
| Threonin | Taurin | |
| Tryptophan | Serin | |
| Valin |
Damit das Protein überall in unserem Körper seine Funktion erfüllen kann, müssen gesunde Erwachsene täglich und über den Tag verteilt 0.8 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen. Das sind bei einer 70kg schweren Person 56g. Das wäre zum Beispiel ein Ei, ein Becher Hüttenkäse (200g) und ein Becher Magerquark (250g).
Ab 65 erhöht sich der Bedarf auf 1 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht: Mit zunehmendem Alter verringert sich die Fähigkeit der Skelettmuskulatur, die Proteinsynthese als Reaktion auf Aminosäuren und Proteine, Insulin oder körperliche Betätigung zu steigern (anabole Resistenz). Wir müssen also mehr Protein aufnehmen. Manche empfehlen bis 1.5g.
Auch nach Krankheiten, Operationen oder verletzungen erhöht sich der Proteinbedarf. Proteine sind die Bausteine des Körpers, sie tragen entscheidend zur Regeneration, dem Wiederaufbau von Gewebe und zur Wundheilung bei. Zudem unterstützen sie die Funktion der Organe und sorgen für den Erhalt der Muskeln.
Proteine sind die Baustoffe, die wir brauchen, um Gewebe zu verstärken, Angreifer zu vernichten und muskeln aufzubauen. Unsere Muskulatur ist dabei auch ein Baustofflager, in dem 60% unseres Proteins aufbewahrt wird.
Nach dem Sport ist die Muskelproteinsynthese für einige Stunden deutlich höher, unabhängig von der Art der Belastung. Deshalb sollte man direkt nach dem Training Proteine einnehmen. Viele Proteinpulverhersteller sagen spätestens 15-30 Minuten nach dem Training, andere empfehlen 3-4 Stunden. Gleichzeitig gehen neuere Studien von einem längeren Fenster von bis zu 24 Stunden aus, manche nennen sogar bis 48 oder 72 Stunden. Wer über den Tag verteilt ausreichend Proteine zu sich nimmt, sollte in jedem Fall gut bedient sein. Die meisten Menschen machen alles richtig, auch wenn sie nicht immer jedes kleinste Detail maximal optimieren.
Spezielle Aufmerksamkeit in Bezug auf den Eiweisskonsum ist für all jene wichtig, deren Ernährung Besonderheiten aufweist. Wird auf bestimmte Lebensmittel verzichtet, weil man sich vegetarisch oder vegan ernährt, aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten oder weil sie saisonal oder regional nicht verfügbar sind, müssen die dadurch nicht in der Nahrung verfügbaren Proteine auf anderem Weg eingenommen werden. Entweder, indem von geeigneten Lebensmittel entsprechend mehr gegessen wird, oder mit Hilfe von Supplementen. Das gilt auch für Menschen, die Diäten einhalten oder aus anderen Gründen wenig essen. Wer wenig isst, nimmt in der Folge auch weniger Proteine zu sich. Schliesslich sollten auch jene auf ausreichende Proteinzufuhr achten, die einen erhöhten Proteinbedarf haben: ältere Menschen, Sportler oder Rekonvaleszente.
Gesunde Erwachsene aber, die sich regelmässig bewegen und ausgewogen ernähren, nehmen in aller Regel ausreichende Mengen an Protein zu sich. Die traditionellen Küchen der Welt sind überall entstanden aus der idealen Kombination von saisonal Verfügbarem und den optimalen Nährstoffen. Die Erfahrung der Menschheit diesbezüglich ist unübertroffen empirisch. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass es unterschiedliche Proteinqualitäten gibt und damit die biologische WErtigkeit einiger Lebensmittel höher ist als bei anderen. Die Liste enthält bis auf Soja und Reis, sowie die schon länger anwesende Kartoffel, jene Lebensmittel, die Menschen in unseren Breitengraden seit Jahrhunderten essen. In vielen REgionen der Welt gehören Reis und Bohnen zu den zentralen Nahrungsmitteln ihrer Küche, für unsere Region erklärt die Liste sehr gut, warum Reis und Kartoffeln sich bei uns schnell und nachhaltig im Alltag durchgesetzt haben.
| Lebensmittel und Kombination | Biologische Wertigkeit |
| Kartoffel (2/3) und Ei (1/3) | 136 |
| Milch und Roggenmehl | 100 |
| Vollei | 100 (= Referenzwert) |
| Quark | 98 |
| Kartoffeln | 95 |
| Kuhmilch | 88 |
| Rindfleisch | 86 |
| mageres Schweinefleisch | 84 |
| Hartkäse | 84 |
| Soja | 84 |
| Reis | 83 |
| Roggenmehl | 80 |
| Kasein (Teil von Milcheiweiss) | 70 |
| Bohnen | 60 |
| Weizenvollkornmehl | 59 |
| Weissmehl (Weizen) | 39 |
Tatsächlich sind viele überzeugt, dass sie ausreichend mit Protein versorgt sind. In den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass dies auch stimmt. Insbesondere bei älteren Menschen, nach Krankheiten oder Verletzungen und oft während Diätkuren, ist die subjektive Wahrnehmung allerdings nicht selten trügerisch. Dann lohnt es sich, eine Woche lang zu protokollieren, wie viel Protein man regelmässig zu sich nimmt. Liegt der Tagesdurchschnitt zwischen 0.8 und 1 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht, kann man sich getrost zurücklehnen. Isst man zu wenig, empfiehlt es sich aber, von den Proteinhaltigen Lebensmitteln, die man bereits im Speiseplan hat, etwas mehr zu sich zu nehmen und einige der Proteinarmen vielleicht durch proteinreichere Alternativen zu ersetzen.
| Lebensmittel | Menge | Protein |
| Ei | 1 Stück | 6g |
| Hüttenkäse | 200g | 24g |
| Magerquark | 250g | 30g |
| Haferflocken | 30g | 3.6g |
| Total/Tag: | 63.6g | |
| Linsen | 200g | 18g |
| Hähnchenbrust | 150g | 45g |
| Total/Tag: | 63g | |
| Vollmilch | 2dl | 6.6g |
| Kichererbsen | 125g | 10g |
| Rindfleisch | 150g | 40g |
| Kartoffeln | 200g | 3.6g |
| Total/Tag: | 60g | |
| Thunfisch (Wasser) | 100g | 23g |
| Mozzarella | 150g | 27g |
| Emmentaler | 50g | 14g |
| Total/Tag: | 64g |
Für all jene, die sich speziell ernähren oder zum Beispiel aufgrund einer Laktose-Intoleranz oder einer fettarmen Diät einen Mangel an Proteinen nicht ohne weiteres mit einem Mehrkonsum oder proteinreichen Alternativen kompensieren können, sind Protein-Supplemente durchaus eine sinnvolle Sache. Es gibt eine riesige Auswahl davon – wer sich darin verliert, kann sich auf zwei Dinge konzentrieren: Hochwertige Proteinprodukte wählen und ein Produkt finden, das einem schmeckt und in den eigenen Menuplan passt, damit man sie auch wirklich täglich nimmt. Dann lohnt sich die Investition und man kann die oft künstlich verteuerten High-Protein Produkte getrost ignorieren.