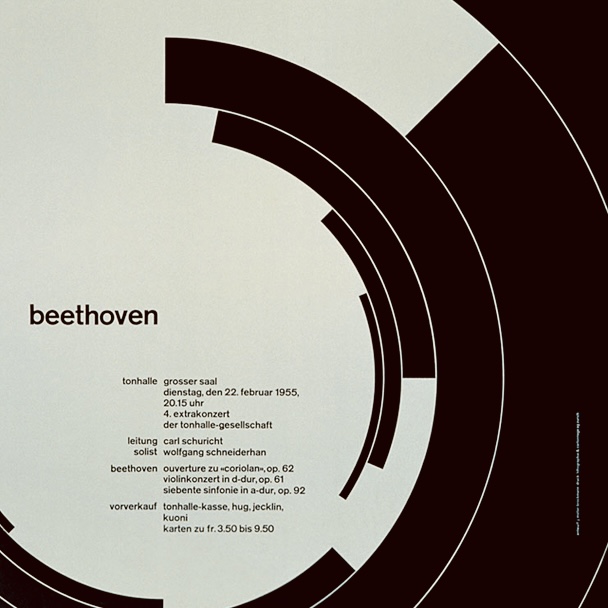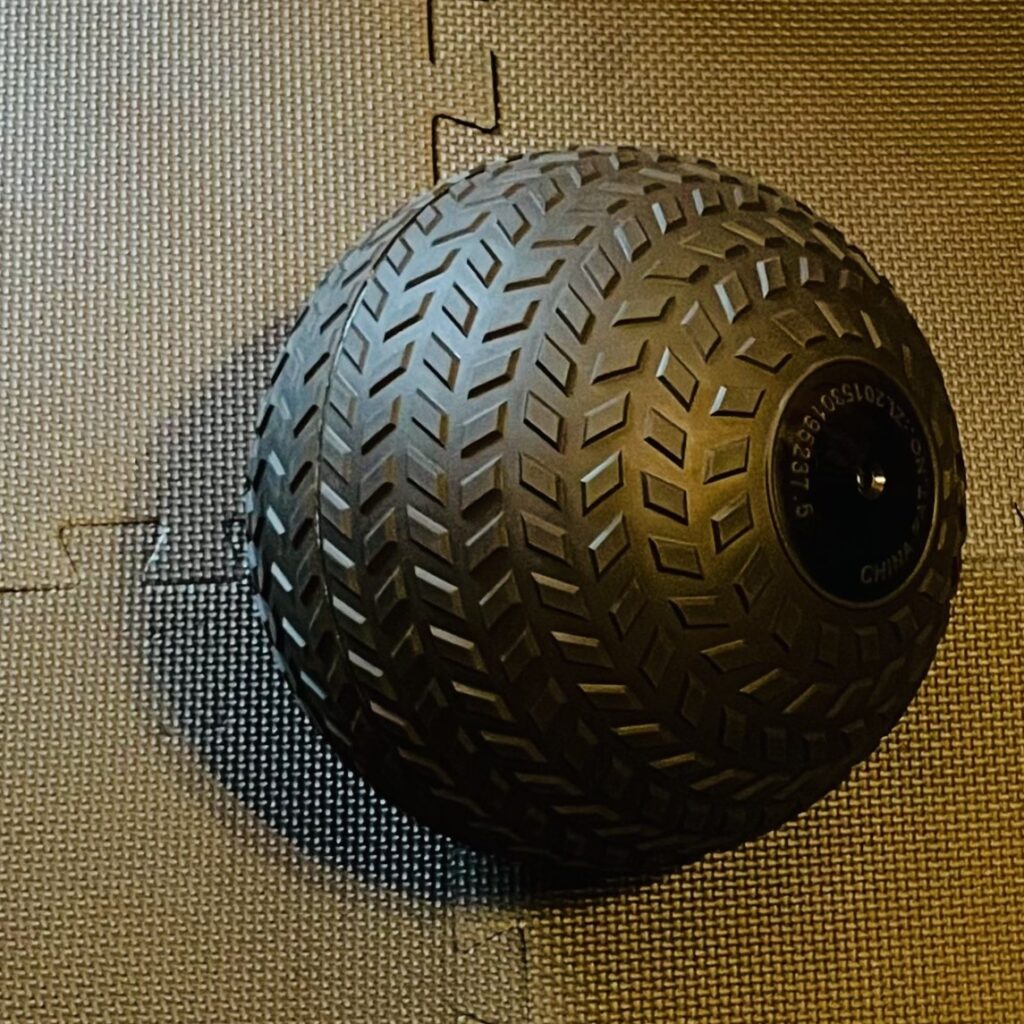Ein Klarer Kopf in einem starken Körper.
Bewegung bringt Klarheit. Mentale Gesundheit als eigentliches Ziel von Training: Mens sana in corpore sano – das Zitat stammt aus den Satiren des römischen Dichters Juvenal: Beten, meinte er, solle man allenfalls um körperliche und geistige Gesundheit. Erst später wurde der Satz im Sinne von „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“ als Ausdruck für das Gleichgewicht von körperlicher und geistiger Fitness interpretiert. Oder eine gesunde Seele in einem gesunden Körper: anima sana in corpore sano – das entsprechende Akronym ist als Sportartikelmarke bekannt.
ADHS und TRAINING
Die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung zeigt sich vor allem durch Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Dazu kommen häufig Defizite in den sogenannten Exekutivfunktionen – also in Planung, Steuerung, Impulskontrolle und Arbeitsgedächtnis. Menschen mit ADHS-Tendenzen profitieren nicht nur körperlich vom Training: Studien zeigen, dass Bewegung auch mentale Prozesse, Stimmung und Schlaf positiv beeinflussen kann. Bewegung ersetzt keine Therapie, sie kann aber eine wertvolle Ergänzung sein.
Warum Training bei ADHS wirkt
Bewegung führt zu erhöhtem Dopamin und Noradrenalin im Körper, das sind genau jene Neurotransmitter, die bei ADHS oft dysreguliert sind. Gleichzeitig aktiviert Training Wachstumsfaktoren (BDNF) und verbessert die Vernetzung im Gehirn. Das stärkt die Exekutivfunktionen: Aufgaben lassen sich besser strukturieren, Impulse leichter kontrollieren und Informationen effektiver speichern. Da Menschen mit ADHS oft unter Schlafproblemen oder unregelmässigen Tagesrhythmen leiden, kann sportliches Training hier zusätzlich stabilisierend wirken.
Für Menschen mit ADHS sind Lärm und Hektik eines martialisch vollgepackten Fitnesscenters, standardisierte Trainingspläne und übermotiviertes Anfeuern eines Fitnessinstruktors alles andere als ideal. Das Gewusel raubt Fokus und Energie – Motivationsfloskeln und monotone Routinen nehmen jede Freude am Training.
Besonders geeignet ist für Personen mit ADHS deshalb ein Personaltraining-Setting in einer ablenkungsfreien Umgebung: Es bietet eine stabile Routine, klare Strukturen und direkte Rückmeldung – ideale Voraussetzungen, um am Ball zu bleiben. Hyperaktivität zeigt sich häufig als überschüssige oder fehlgeleitete Energie. Im passenden TRaining wird Bewegung hingegen zum Kanal, motorische Aktivierung zur Energie-Regulation.
Personaltraining als Begleitung bei ADHS
Kurzfristig verbessern sich Aufmerksamkeit und Impulskontrolle im Alltag. Regelmässige Trainingstermine schaffen Tages- und Wochenstruktur, was vielen Betroffenen schnell spürbar guttut. Mittel- und langfristig verbessert sich die Schlafqualität, und die Exekutivfunktionen werden stärker. Mit der Zeit nimmt auch die innere Unruhe ab.
Obwohl Sport und Bewegung allgemein hilfreich sind, eignet sich das 1:1-Setting beim Personaltraining besonders für Menschen mit ADHS. Durch die direkte Betreuung und volle Konzentration kann der Personaltrainer helfen, individuelle Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören Kurze, klare Instruktionen, Visuelle Timer und Countdowns, klare Handlungsaufforderungen und messbare Ziele.
DAnk dem Wissen über Varianten einer Übung kann ein Personaltrainer auch die für Menschen mit ADHS wichtige ABwechslung und Vielfalt bieten. Diese Elemente fördern Autonomie, erhöhen die Motivation und unterstützen langfristige Trainingsadhärenz, also die Kontinuität des Trainings und die Einhaltung begleitender Elemente.
Spezielle Hinweise
Wie immer, wenn Medikamente eingenommen werden, sollten Puls und Blutdruck beobachtet und gegebenenfalls ärztliche Rücksprache gehalten werden. Wichtig ist, Überforderung zu vermeiden: zu hohe Intensität oder Trainingshäufigkeit kann kontraproduktiv wirken und zu Motivationsverlust führen. Eine ruhige, strukturierte Umgebung hilft, den Fokus zu halten und Reizüberflutung zu vermeiden.
Für Menschen mit ADHS ist Training nicht nur gesund und fördert die körperliche Fitness, sondern bietet auch grosse Chancen für die Lebensqualität: mentale Stärke, Alltagsstruktur und echte Entlastung der Symptome. Im Atrium Gym finden sich ideale Voraussetzungen für Menschen mit ADHS: Ein ruhiger, warmer Raum, der Konzentration fördert, kombiniert mit klarer Struktur und fundierter Expertise in Trainings- und Ernährungslehre sowie Functional Training. Nicht zuletzt schafft auch die eigene Erfahrung der Trainerin mit ADHS ein optimales, empathisches und praxisnahes Setting.
Wenn du herausfinden möchtest, wie gezieltes Training dir helfen kann, mehr Struktur, Energie und innere Ruhe zu finden, begleite ich dich gern ein Stück auf deinem Weg.